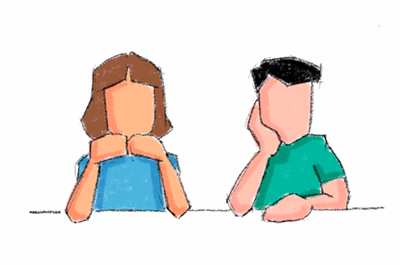
Wissen
Trennung und Scheidung
Trennungen sind eine Zeit der emotionalen Turbulenzen, in der es oft eine enorme Herausforderung darstellt, sich zusätzlich noch um die vielfältigen finanziellen Aspekte zu kümmern. In solchen schwierigen Momenten ist es entscheidend, den Überblick über die finanzielle Situation zu behalten, um auf festem Boden stehen zu können. Hier findest du kompakt die wichtigsten Informationen.
Unabhängig davon, ob eine Trennung vorübergehender Natur ist oder das definitive Ende einer Beziehung einläutet: Orientierungshilfen sind gefragt, vor allem wenn auch Kinder involviert sind. Mittlerweile gibt es viele hilfreiche Bücher zu diesem Thema. Insbesondere empfehlen wir die Ratgeber der Beobachter Edition.
Die Erfahrung aus der Beratung zeigt, dass gute Lösungen das Wohl aller im Auge behalten. Dazu gehören Fragen wie:
- Wann und wie informieren wir das gemeinsame Umfeld?
- Wann und wie sagen wir es den Kindern?
- Wer bleibt in der bisherigen Wohnung?
- Welche Wohnsituation ist die beste für die Kinder?
- Wie wird das Wohnungsinventar aufgeteilt?
- Welches Betreuungsmodell für die Kinder wollen wir leben?
- Je nach Situation gibt es weitere Bereiche, die geregelt werden wollen.
Zum Schluss geht es um die Finanzen und ein Grundverständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Bei einem Ehepaar bzw. einer Lebenspartnerschaft gilt in der Trennungszeit, dass die gegenseitige Auskunfts- und Unterstützungspflicht weiterhin besteht. Natürlich ist es auch für Paare, die nicht verheiratet sind, besser, sich offen und ehrlich über alles zu informieren, was beide betrifft.
Können in der Trennungszeit gemeinsame Lösungen gefunden werden, die die Existenz aller sichern und das Kindswohl nicht gefährden, so ist das grundsätzlich erlaubt. Es wird empfohlen die Regelung schriftlich festzuhalten. Eine aussergerichtliche Einigung hat den Vorteil, dass eher massgeschneiderte Lösungen zustande kommen und dass keine Gerichtskosten anfallen. Können sich die Eltern nicht einigen oder hat ein Konkubinatspaar keine passende Unterhaltsregelung, so muss die Trennung im Streitfall gerichtlich geregelt werden. Dasselbe gilt, wenn eine existenzielle Notlage entsteht und damit ein Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe geprüft werden muss.
Für die meisten Familien bedeutet eine Trennung/Scheidung eine spürbare Einbusse an Lebensstandard. Es ist zu empfehlen, für die Regelung des Unterhalts von Anfang an mit offenen Karten zu spielen. Werden Einkommen angesichts der Trennung bewusst gesenkt, so kann ein Gericht Annahmen über das effektiv erzielbare Einkommen treffen oder auch von einem zusätzlichen hypothetischen Einkommen ausgehen. Die Anpassung der Ausgaben an die neue Einnahmensituation braucht Zeit. Hier kann eine Budgetberatung wertvolle Dienste leisten. Sie zeigt wie die Anpassung gelingen kann bzw. wo die Grenzen des neuen Budgets liegen.
Praxistipp:
- Nutzen Sie unsere Budgetvorlagen zum Erstellen eines Budgets.
- Nehmen Sie, wenn nötig, Beratung in Anspruch. Viele Eltern schätzen den Austausch mit einer Fachperson und gewinnen so Sicherheit bei der Einschätzung der Situation. Eine Beratungsstelle des Dachverbands in ihrer Nähe finden Sie hier.
Hinweis: Ein detailliertes Budget gemäss den Vorlagen des Dachverbands unterscheidet sich von einer betreibungsrechtlichen Bedarfsberechnung dahingehend, dass nicht mit Pauschalen gerechnet wird, sondern detailliert aufgezeigt wird, was die Positionen kosten. Dies bedeutet, dass Kosten für Ernährung, Kleidung, Energiekosten, Mobilität, Handyabonnemente etc. separat erfasst werden. In der betreibungsrechtlichen Bedarfsberechnung sind sie jedoch in den Grundbeträgen enthalten. Mit einer detaillierten Berechnung wird klar wie viel für jeden Budgetposten zur Verfügung steht und wo allenfalls Sparpotenzial zu finden ist.